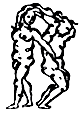 ild
ild
|
Am zweiten Tag der Reise fand die Wache frühmorgens |
- Hans Magnus Enzensberger, Der Untergang der Titanic.
Eine Komödie. Frankfurt am Main 1978
Bild (2) Nun
muß erklärt werden, auf welche Weise das System
das einschließt, was sich nicht als System auszeichnet. Es soll hier von
den BILDERN die Rede sein. Die BILDER gehören nicht zum System, und man
weiß auch nicht, woher sie kommen; es kann sein, daß sie in einem gewöhnlich
verlassenen Raum ihren
Ursprung haben, von einem himmlischen Schoß
geboren werden, wenngleich dieser unfruchtbar ist. Die Bilder sind im Raum
unterwegs, sie reisen durch das System; sie fallen
dort ein und verstricken gewissermaßen das System in sich, stiften Verwirrung
und bereiten Kummer; sie verwunden und schinden das System. Die BILDER
sind: das EXIL, der TRAUM, das TIER,
der ZAHN. Das EXIL geht einher wie eine große silberne
Wolke, weit ausgedehnt und zugleich abstrakt, vielleicht unfähig, sich
eine Form zu geben, oder sich gegen eine Form sträubend. Das Exil hüllt
im Grunde genommen das gesamte System nicht ein, sondern beleckt
es seiner Natur entsprechend, wie wir zu sagen wagen, anspielungsweise.
Es streift die ORTE nur, geht nicht bis zur Mitte
des Platzes vor. Aber wenn stillschweigend und begehbar das Bild des EXILS
auftritt, erfaßt ein Beben das System, die ORTE und die Zusammenballungen
der Mitte. Rotation und Nutation, Laufen
und Nachlaufen werden langsamer und unsicherer; und eine Art Verhör dringt
durch den Raum des Systems. Die FEUER werden aschfarben,
ihre gewohnte Raserei schwindet; die ERBAUTIERE
werden lauter weinerliche Hirsche, und den ZENTREN
vergeht ihre Angriffslust. Einzig herrscht die schattige Natur der NEIN
in vollkommener Stille, mit höchster Würde und Eleganz, und das Nein wird
zur Maßeinheit für das gesamte System. Überall verbreitet sich eine merkwürdige
Langsamkeit, selbst das Ideogramm sieht verquält und bleicher aus, beinahe,
als wollte es sich einer philologischen Untersuchung von selten des EXILS
entziehen. Man glaubt nämlich, daß das EXIL, welches weder Zunge
noch Ohren noch Tastsinn hat, sich weder nährt noch
wächst noch hinfällig wird, trotzdem imstande sei zu sehen;
womit, weiß zwar niemand, und es ist auch kaum vorstellbar, denn Augen
hat es nicht; es könnte jedoch sein, daß das schwache Schimmern des EXILS
ein sehfähiges Licht ist, womöglich vom Glanz der FEUER
genährt, deren blutleeres Phosphoreszieren dann daher kommen würde, daß
ihnen das EXIL eine Art Lichttribut abverlangt. Wie dem auch sei, bei den
ORTEN und auf dem Platz in der Mitte des Systems
ist die Überzeugung verbreitet, daß das EXIL beobachtet; daher das vorsichtige,
langsame Beben, das sich überall verbreitet; daher das Mißtrauen der ESSENZEN,
die Vorsicht der THRONE, die Enthaltung
der PROPHEZEIUNGEN, die Nachdenklichkeit der ERINNERUNG.
- Giorgio Manganelli, System. In: (irrt)
Bild (3) Das Fleisch
der Frau hat wohl schon immer eine große Rolle in
meinen Träumen gespielt. Selbst im Wachen erliege
ich den Bildern, die es mir aufdrängt. Eine junge Frau im Sommerkleid zeigt
den gebeugten Nacken - sie befestigt ihre Sandaletten -, das Haar fällt
nach vorn und entblößt die zarte Haut und den blonden Flaum, und sofort
sehe ich sie einer Neigung zu Willen, die schnell zur Ausschweifung wird.
Der hautenge, bis zum Schenkel geschlitzte Rock der Schönen von Hongkong
zerreißt blitzschnell unter einer gewalttätigen Hand, die plötzlich eine
pralle, feste, glatte, glänzende Hüfte freilegt und die weiche Rundung
des Hinterteils. Die Lederpeitsche im Schaufenster eines Pariser Luxusgeschäfts,
die nackten Brüste einer Wachspuppe, ein Theaterplakat, die Reklame für
Strumpfhalter oder für ein Parfum, zwei feuchte geöffnete Lippen, eine
eiserne Armspange, ein Hundehalsband errichten rund um mich ihre aufdringliche,
aufreizende Kulisse. Ein schlichtes Pfostenbett, eine dünne Schnur, das
brennende Ende einer Zigarre begleiten mich stundenlang, reisen mit mir,
tagelang. In den Gärten organisiere ich Feste. Für die Tempel stelle ich
Zeremonien auf, leite die Opfer. Die Paläste der Araber oder Moguln erfüllen
meine Ohren mit Schreien und Seufzern. Die symmetrisch geteilten Marmorschnitte
an den Wänden der byzantinischen Kirchen werden unter meinen Augen zu Darstellungen
des weitgeöffneten, klaffenden weiblichen Geschlechts. Zwei Ringe, in der
Tiefe eines altrömischen Kerkers in den Stein geschmiedet, genügen, um
die schöne angekettete Sklavin zu beschwören, die langen Martern geweiht
ist, im Verborgenen, in der Einsamkeit, in der Zeitlosigkeit. - Alain
Robbe-Grillet, Die blaue Villa in Hongkong. München 1969 (dtv 548, zuerst
1965)
Bild (4) Hat man sich lange genug in
so ein Bild vertieft, erkennt man, wie sehr auch hier die Gegensätze sich
berühren: die exakteste Technik kann ihren Hervorbringungen einen magischen
Wert geben, wie für uns ihn ein gemaltes Bild nie mehr besitzen kann. Aller
Kunstfertigkeit des Photographen und aller Planmäßigkeit in der Haltung
seines Modells zum Trotz fühlt der Beschauer unwiderstehlich den Zwang,
in solchem Bild das winzige Fünkchen Zufall, Hier
und Jetzt, zu suchen, mit dem die Wirklichkeit den Bildcharakter gleichsam
durchgesengt hat, die unscheinbare Stelle zu finden, in welcher, im Sosein
jener längstvergangenen Minute das Künftige noch heut und so beredt nistet,
dass wir, rückblickend, es entdecken können. Es ist ja eine andere Natur,
welche zur Kamera als welche zum Auge spricht; anders
vor allem so, dass an die Stelle eines vom Menschen mit Bewusstsein durchwirkten
Raums ein unbewußt durchwirkter tritt. - Walter Benjamin
Bild (5) Eine der größten Gefahren,
die dir drohen, ist, daß Hunderte inferiorer Schlauköpfe (Spitzel) ein
Mosaikbild von dir zusammenstellen, das zu dir paßt wie die Faust aufs
Auge. Verhindern kannst du es nicht, nur die Folgen so abschwächen, daß
du kein Opfer der Justiz wirst. - (ser)
Bild (6) Der entscheidende Grund für
das Bedürfnis, alles zu fotografieren, liegt in der Logik des Konsums selbst.
Konsumieren heißt verbrennen, verbrauchen - und beinhaltet damit zugleich
das Streben nach Ergänzung. Indem wir Bilder machen und sie konsumieren,
provozieren wir in uns das Bedürfnis nach mehr und mehr Bildern. Aber Bilder
sind kein Schatz, nach dem die Welt durchforscht werden muß; sie sind zuhanden,
wohin das Auge blickt. Der Besitz einer Kamera kann ein Gefühl erwecken,
das durchaus eine Art von Wollust ist. Und wie
alle echten Formen der Wollust, kann auch sie nicht befriedigt werden:
und zwar zum einen deshalb, weil die Möglichkeiten der Fotografie unendlich
sind, und zum andern, weil dieses Unterfangen sich letztlich selbst ad
absurdum führt. Die Versuche von Fotografen, einen erschöpften Wirklichkeitssinn
künstlich am Leben zu halten, bewirken nichts als das Gegenteil. Unser
niederdrückendes Gefühl der Flüchtigkeit aller Dinge hat sich nur noch
verstärkt, seit uns die Kamera die Möglichkeit gegeben hat, den flüchtigen
Augenblick zu »fixieren«. Wir konsumieren Bilder mit ständig wachsender
Geschwindigkeit, und - man denke an Balzacs Vermutung, daß die Kamera
Schichten des Körpers verbrauche - Bilder konsumieren
die Realität. Die Kamera ist Gegengift und Krankheit
zugleich, Mittel zur Aneignung der Realität und Mittel zu ihrer Abnutzung.
- Susan Sontag, Über Fotografie. Frankfurt am Main 2003 (Fischer-Tb. 3022,
zuerst 1977)
Bild (7) Die Bilder verdecken
mehr als sie enthüllen. Sie gehen nicht in die Tiefe, wo alle Widersprüche
mit einander korrespondieren. Die Darstellung eines Vorganges ist hier
nur ein Mittel zum Geldverdienen. In dieser Beziehung sind die Bilder der
Kronen-Zeitung eindeutiger und darum minderwertiger
als die primitiven Holzschnitte der alten Jahrmarktsmoritaten. Die boten
noch einen Anreiz der Phantasie, mit welcher man über sich hinausreichen
konnte. Das tun diese Zeitungen nicht. Sie brechen der Vorstellungskraft
die Flügel. Das ist ganz natürlich. Je mehr sich die Bildertechnik verbessert,
um so schwächere Augen haben wir. Der Apparat
lähmt die Organe. So ist es mit der Optik, in der Akustik, im Verkehrswesen.
Durch den Krieg ist Amerika nach Europa gekommen. Die Kontinente haben
sich ineinandergeschoben. Ein Funke trägt die menschliche Stimme im Nu
um die Erde. Wir leben nicht mehr in menschlich beschränkten Räumen,
sondern auf einem kleinen, verlorenen Stern, umgeben von Milliarden großer
und kleinerer Welten. Der Weltraum tut sich auf wie ein Rachen.
- Franz Kafka, nach: Gustav Janouch, Gespräche
mit Kafka. Aufzeichnungen
und Erinnerungen. Frankfurt am Main 1981 (Fischer Tb. 5093, zuerst 1954)
Bild (8) ein unbewegliches
stummes Bild inmitten anonym bleibender alltäglicher Vorgänge, das er behalten
hatte, im ersten Augenblick erschreckt durch
die bloße Nacktheit der vorgezeigten dicken Glieder, die er beim Eintritt
von der Seite aus sehen konnte, schließlich auf eine unklar bleibende Art
abgestoßen davon und undeutlich erregt oder nicht unmittelbar davon erregt,
doch empfänglich augenblicklang für diese vorgezeigte Blöße, die Bewegung
der Hände unten und die schweigsam starre Erregung, dieses kalte Glimmern
in der Abgeschiedenheit des Toilettenraums nachmittags -- (brink)
Bild (9) Fotos,
herausgenommen aus dem Kopf und als Vorstellung an die Wände projiziert,
von den Zimmerwänden zurückgefedert in den Kopf als ein feststehender Bildraster
für die Außenwelt, ein festes System von Bezugspunkten aus glatten nackten
Hautstücken, flachen kleinen Hintern, kindlichrunden Wölbungen, Schultern,
gebeugten Nacken, Haar, das weich wegfällt und nicht riedit, die Achselhöhlen
ausrasiert, kleine weiße Mulden, die Brüste kaum merklich nach unten hängend
mit der Spitze nach oben, Körper, ohne Gewicht ausgedacht, äußerst fragile
Gestalten in leichten, elegant lose dekorierten Kleidungsstücken, zu leicht,
um sie fester an sich heranziehen zu können, sie anzufassen, ganz eingetaucht
in ein poröses, feinkörnig sprödes Licht, die Gesichter
in dem elektrischen Licht halb weggerutscht bis auf einige angedeutete
Linien, Lippen, Wangenknochen, das Kinn, die Stirn sich fortsetzend immer
so weiter in einem imaginären Raum, ausgedehnt im Kopf und dort in dem
randlosen Raum flackernd, das Flackern der Bilder selbst auch imaginär,
immer weiter eines ins andere geronnen. - (brink)
Bild (10) Mit den surrealistischen Bildern geht es wie mit jenen Bildern im Opiumrausch, die der Mensch nicht mehr evoziert, sondern die sich ihm spontan, tyrannisch anbieten. Er ist unfähig, sie abzuweisen; denn der Wille ist kraftlos geworden und beherrscht nicht mehr seine Fähigkeiten» (Baudelaire). Bleibt die Frage, ob man jemals die Bilder «evoziert» hat. Wenn man sich wie ich auf die Definition Reverdys stützt, scheint es unmöglich, seine besagten «zwei voneinander entfernten Wirklichkeiten» absichtlich einander zu nähern. Entweder es geschieht eine Annäherung oder nicht, das ist alles. Ich für meinen Teil verneine ganz entschieden, daß Bilder bei Reverdy wie:
Im Bach ist ein Lied das fließt
oder
Der Tag hat sich entfaltet wie ein weißes Tischtuch
oder
Die Welt kehrt zurück in eine Tasche
die geringste vorhergehende Überlegung enthalten. Meines Erachtens ist es verkehrt, zu behaupten, daß von den zwei gegebenen Wirklichkeiten «der Geist die Beziehungen erfaßt habe». Zuerst einmal hat er überhaupt nichts bewußt erfaßt. An der sozusagen zufälligen Annäherung der beiden Ausdrücke hat sich ein besonderes Licht entzündet, ein Licht des Bildes, für das wir unendlich empfänglich sind. Der Wert des Bildes hängt ganz von der Schönheit des erzielten Funkens ab; ist also folglich die Funktion des Spannungsunterschieds zwischen den beiden Leitern. Wenn dieser Unterschied nur sehr schwach ist, wie im Vergleich, kommt es zu keinem Funken. Nun ist aber nach meinem Dafürhalten der Mensch nicht befähigt, die Annäherung zweier so weit voneinander entfernter Wirklichkeiten zu bewerkstelligen. Das Prinzip der Ideenassoziation, wie wir es kennen, stellt sich dem entgegen. Oder man müßte eine elliptische Kunst zu Hilfe nehmen, die jedoch sowohl Reverdy wie ich verwerfen. Man muß also wohl oder übel zugeben, daß die beiden Begriffe, die das Bild ausmachen, vom Geist nicht etwa mit Absicht auf den zu produzierenden Funken voneinander abgeleitet wurden, sondern daß sie das Ergebnis eines Vorgangs sind, den ich surrealistisch nenne, wobei die Vernunft sich darauf beschränkt, das Licht-Phänomen festzustellen und zu würdigen.
Und so wie der Funke sich stärker ausdehnt, wenn er durch verdünnte Gase gejagt wird, so ist die surrealistische Atmosphäre, die durch das mechanische, automatische Schreiben geschaffen wird, das ich jedermann zugänglich zu machen suchte, für die Gewinnung der schönsten Bilder besonders geeignet. Man kann sogar sagen, daß die Bilder in diesem schwindelerregenden Ablauf als die einzigen Anhaltspunkte des Geistes erscheinen. Allmählich gewinnt der Geist Gewißheit von der höchsten Realität solcher Bilder. Begnügt er sich zunächst damit, sie nur zu ertragen, so begreift er bald, daß sie seine Intelligenz unterstützen, seine Einsicht vertiefen. Er macht sich die unbegrenzte Weite bewußt, wo sich seine Wünsche formen, wo sich Für und Wider ständig aufheben, wo ihn seine Unsicherheit nicht preisgibt. Er geht voran, getragen von diesen Bildern, die ihn bezaubem und ihm kaum Zeit lassen, auf seine glühenden Finger zu blasen. Die schönste aller Nächte, die Nacht der Blitze: neben ihr ist der Tag Nacht.
Die unzähligen Formen surrealistischer Bilder würden eine Einteilung
rechtfertigen, die ich jedoch heute nicht vornehmen möchte. Sie nach ihrer
Zusammengehörigkeit zu ordnen, würde zu weit führen; ich will mich im wesentlichen
an ihre gemeinsame Stärke halten. Das stärkste Bild, muß ich gestehen,
ist für mich das, das von einem höchsten Grad von Willkür
gekennzeichnet ist. - André Breton, Das erste surrealistische
Manifest (1925). In: A.B., Die Manifeste des Surrealismus. Reinbek bei
Hamburg 1986 (re 434)
Bild (11) Wen der Terror
der Bilder nicht zum Terroristen macht, den macht er zum Voyeur. Jeder
von uns sieht sich auf diese Weise einer permanenten Erpressung ausgesetzt.
Denn nur wer zum Augenzeugen gemacht wird, taugt als Adressat der vorwurfsvollen
Frage, was er denn gegen das, was ihm gezeigt wird, unternehme. So erhebt
sich das korrupteste aller Medien, das Fernsehen, zur moralischen Instanz.
- H. M. Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg. Frankfurt
am Main 1993
Bild (12) Es versteht sich
von selbst, daß einem Gespenste nicht
die unmittelbare Realität eines gegenwärtigen Objekts beizulegen ist; wiewohl
ihm mittelbar doch eine Realität zum Grunde liegt:
nämlich was man da sieht ist keineswegs der Abgeschiedene selbst, sondern
es ist ein bloßes eidolon, ein Bild Dessen, der ein Mal war, entstehend
im Traumorgan eines hiezu disponirten Menschen; auf Anlaß irgend eines
Ueberbleibsels, irgend einer zurückgelassenen Spur. Dasselbe hat daher
nicht mehr Realität, als die Erscheinung Dessen, der sich selbst sieht,
oder auch von Ändern dort wahrgenommen wird, wo er sich nicht befindet.
Fälle dieser Art aber sind durch glaubwürdige Zeugnisse bekannt, von denen
man einige in Horst's Deuteroskopie Bd. 2, Abschn. 4 zusammengestellt
findet: auch der von Goethe erwähnte
gehört dahin; desgleichen die nicht seltene Thatsache, daß Kranke, wann
dem Tode nahe, sich im Bette doppelt vorhanden wähnen.
»Wie geht es?« fragte hier vor nicht langer Zeit ein Arzt seinen schwer
darniederliegenden Kranken: »Jetzt besser, seitdem wir im Bette zwei
sind«, war die Antwort: bald darauf starb er. - (schop)
Bild (13)
|
BILDER Siehst du auf Bildern in den Galerien brüchige Felle, Stoppeln, käsiger Bart, ein Lebensabend, reichliches Dekor, siehst du auf Bildern in den Galerien, |
- (benn)
Bild (14) Beim Malen
müssen sich Auge und Gehirn
gegenseitig unterstützen, man muß an ihrer wechselseitigen Ausbildung arbeiten
durch logische Entwicklung von Farbeindrücken. Dann wären die Bilder
Konstruktionen vor der Natur. - Alles in der Natur modelliert sich wie
Kugel, Kegel und Zylinder. Man muß auf Grund dieser einfachen Formen malen
lernen, dann wird man alles machen können, was man will. Man darf
die Zeichnung nicht von der Farbe
trennen. Das ist, als ob Sie ohne Worte denken wollten, mit bloßen Chiffren
und Zeichen. Zeigen Sie mir etwas Gezeichnetes in der Natur. Es gibt
keine Linie, es gibt keine Modellierung, es gibt nur Kontraste. Aber die
Kontraste sind nicht Schwarz und Weiß, sondern Farbbewegungen. Modellierung
ist nichts als Richtigkeit in der Beziehung der Farbtöne. Sind sie richtig
nebeneinandergesetzt und alle da, so modelliert sich das Bild von selbst.
Im selben Grad, wie man malt, zeichnet man. Je harmonischer
die Farbe wird, desto präziser wird die Zeichnung. Wenn die Farbe den höchsten
Reichtum zeigt, zeigt die Form die größte Fülle. Die Kontraste und Übereinstimmungen
der Farbtöne: darin liegt das Geheimnis der Zeichnung und Modellierung,
Man sollte nicht sagen Körper modellieren, sondern Farben modulieren.
- Cézanne, nach: Walter Hess (Hg.), dokumente zum verständnis
der modernen malerei. Reinbek bei Hamburg 1964 (rde 19)
Bild (15) Es ist merkwürdig,
daß Menschen niemals damit zufrieden sind, die Dinge so zu nehmen, wie
sie kommen. Das menschliche Bewußtsein wirkt wie ein Puffer, der uns vor
der rauhen Wirklichkeit schützt. Es erschafft Symbole oder Bilder der Wirklichkeit
für uns. Diese Fähigkeit, sich die Welt auf eine knappe Weise bildhaft
vorzustellen, ist für unsere Evolution und unser Überleben notwendig. Um
aus der Erfahrung zu lernen, müssen wir Möglichkeiten haben, Information
über die Umwelt, in der wir leben, zu sammeln und zu speichern. Wenn wir
erkennen, daß das, was wir wahrnehmen, nur eine Vorstellung
der Wirklichkeit ist und sich möglicherweise wesentlich
von ihr unterscheidet, haben wir die Philosophie erfunden. Schon immer
haben Philosophen mit dem Problem gerungen,
in welcher Beziehung die Welt, wie sie ist, zu unserer Wahrnehmung steht,
die unsere Sinne uns von ihr vermitteln. Wir können darauf vertrauen, daß
unser Bild von der Welt zu einem wesentlichen Teil wirklichkeitsgetreu
ist, denn sonst könnten wir hier nicht über diese Themen reden. -
(bar)
Bild (16) Einige Male bin ich
gefragt worden, ob denn ich gar kein Interesse an Menschen nähme, weil anscheinend
ich so wenig hinschaue. Doch sehn, sagte ich, vielleicht nur anders als üblich.
In einer zwölftel Sekunde soll das Auge den Eindruck aufnehmen können, und weiteres
Verweilen am Objekt ist Privatvergnügen. Aber auch, wenn man Menschen nur halb
ansieht, dann werden sie einfacher und größer. Die Freunde, die Feinde und auch
die Indifferenten, sie alle sind meine Helfer, wenn aus dem Unterbewußten sie
hervorsteigend sich wieder melden. Sie sind meine Bilder. Lachet, jubelt, weinet
oder seid glücklich, ihr seid meine Bilder, und der Klang eurer Stimmen, das
Wesen eurer Charaktere in aller Verschiedenheit, ihr seid dem Maler Farben.
- Emil Nolde, nach: Walter Hess (Hg.): dokumente zum verständnis
der modernen malerei. Reinbek bei Hamburg 1964 (rde 19)
Bild (17) Auch die Bilder, wie
sie mir im nachhinein zufliegen oder zugeblitzt werden aus der Sierra, sehe
ich andererseits jeweils in der Gegenwart. Alle derartigen Bilder - um die allein
es mir für meine und unsere Geschichte zu tun ist -, nicht bloß die aus der
Sierra de Gredos, spielen in der Gegenwart. Ja, im Unterschied zu meinen Schrecknissen
und Widrigkeiten werden die Bilder mir spielend gegenwärtig; das Bild selbst
als ein Spiel, in welchem eine grundverschiedene Gegenwart gilt als meine persönliche.
Die Bilder spielen in einer unpersönlichen Gegenwart, die mehr, weit mehr ist
als meine und deine; spielen in der großen Zeit, und in einer einzigen Zeit-Form,
auf welche, wenn ich sie, die Bilder, bedenke, auch nicht ›Gegenwart‹ zutrifft
- nein, die Bilder spielen auch nicht in einer größeren oder großen Zeit, sondern
in einer Zeit und in einer Zeit-Form, für welche beide es weder ein Beiwort
noch überhaupt einen Namen gibt. - Peter Handke, Der Bildverlust oder
Durch die Sierra de Gredos. Frankfurt am Main 2002
Bild (18) Es war fast Mitternacht. Der Mond stand hoch am Himmel. Der illustrierte Mann lag regungslos. Ich hatte gesehen, was zu sehen war. Die Geschichten waren erzählt; sie waren vorbei und verweht.
Nur die leere Stelle auf dem Rücken des illustrierten Mannes, jenes wirre Durcheinander von Farben und Formen, hatte sich mir noch nicht offenbart.
Jetzt, während ich hinaus schaute, begannen die verschwommenen Striche sich zu ordnen, sich aufzulösen, zu verschmelzen, neue Formen anzunehmen. Und schließlich bildete sich ein Gesicht, ein Gesicht, das mir entgegenstarrte, ein Gesicht mit vertrauten Zügen, vertrauten Augen.
Das Bild war sehr verschwommen. Doch ich erkannte genug, um entsetzt aufzuspringen. Zitternd stand ich im Mondlicht, voller furcht, daß der Wind oder die Sterne ein Geräusch machen könnten, das die unheimliche Galerie zu meinen Füßen zum Leben erweckte. Doch er schlief ruhig weiter.
Das Bild auf seinem Rücken zeigte den illustrierten Mann, wie er seine Hände um meinen Hals schloß und mich erwürgte. Ich wartete nicht, bis das Bild klar, scharf und deutlich hervortrat.
Ich rannte die mondhelle Landstraße hinunter, ohne mich noch einmal umzublicken.
Vor mir, dunkel und schlafend, lag eine kleine Stadt. Ich wußte, daß ich sie
lange vor Tagesanbruch erreichen konnte . . . - Ray Bradbury, Der illustrierte
Mann. München 1972 (Heyne 3057)
Bild (19) Simon frevelte nicht nur in der Lehre, sondern er hatte auch Blutschuld auf sich geladen. Denn, wie er selbst seinen Freunden zu erzählen pflegte, hat er im Inneren seines Hauses, dort, wo sich seine Lagerstatt befindet, die Seele eines Knaben verwahrt. Und jene Seele hat er mit Hilfe geheimer Beschwörungen vom Körper des Knaben getrennt und hat ein Bild von ihm gemalt, um ihn so festzuhalten.
Und er behauptete, diesen Knaben einst mit göttlicher Kraft aus Luft gebildet, dann seine Erscheinung im Bild festgehalten und ihn schließlich wieder in Luft verwandelt zu haben.
Der Menschengeist nämlich, so lehrte er, strebe nach dem Warmen und ziehe
die ihn umgebende Luft an und sauge sie ein; und diese Luft verwandle sich im
Inneren des Menschengeists in Wasser. Dort aber verwandle es sich wieder in
Blut, und wenn das Blut gerinne, werde es zu Fleisch. Und das Fleisch verdichte
sich und am Ende bilde sich ein Mensch, der nicht von der Erde komme, sondern
von der Luft. - Das erste Buch der Apostelgeschichten,
nach: Die andere Bibel. Hg. Alfred Pfabigan. Frankfurt am Main 1990
Bild (20) Ein einziges
sich und sie aktivierendes Bild am Tag, und der bekam sein Friedensmuster. Diese
Bilder, obwohl durchwegs menschenleer und ereignislos, handelten von der, einer,
einer Art Liebe. Und sie hatten sie schon von Kind an durchwirkt, an manchen
Tagen weniger, an manchen Tagen als ganze Sternschnup-penschwärme - immer als
zuvor tatsächlich, im Vorbeigehen, Erlebtes -, an manchem Tag ausbleibend: Un-Tag.
Und sie war überzeugt, daß das jedem mehr oder weniger so zustieß. Wohl gehörte
das jeweilige Bildobjekt zu eines jeden persönlicher Welt. Aber das Bild, als
Bild, war universell. Es ging über ihn, sie, es hinaus. Kraft des offenen und
öffnenden Bildes gehörten die Leute zusammen. Und die Bilder waren zwanglos,
anders als jede Religion oder irdische Heilslehre. Nur hatte noch niemand so
recht von solcherart Bildern erzählen können? - Peter Handke, Der Bildverlust.
Frankfurt am Main 2002
Bild (20) Selbst der trockenste Geist kommt nicht ohne Bilder aus. Wo es ihm gelungen scheint, sie aus der Sprache auszumerzen, liegt das daran, daß die von ihm entlehnten Bilder so alt und ausgewalzt sind, daß sie weder ihm, noch den Lesern auffallen. Man darf behaupten, daß Locke und Condillac, der eine um Irrtümer auszurotten, der andere um seine Sätze unangreifbar zu machen, in gleicher Weise gegen das Mysterium der Sprache gefehlt haben. Sie kannten nicht den Zauberklang der Worte, der an die Herzen anklopft und sie erzittern läßt. Soll man ihnen für ihre Ohnmacht Dank wissen? Oder soll man ihnen zubilligen, daß sie die Wirkung auf das Gemüt verschmähen und den bildlosen Stil erwählten, weil es die Würde der Metaphysik gebot?
Ich könnte zunächst nachweisen, daß ein unmittelbarer, bildloser Stil nicht
existiert. Auch Locke und Condillac verwenden Bilder — sei es nun wider Willen
oder unbewußt. Sie nehmen oft zu Metaphern und Vergleichen ihre Zuflucht, und,
wie ich belegen könnte, mit Erfolg. Doch darum geht es mir hier nicht. Ist die
Natur als unser großes Vorbild denn ohne Gleichnis, der Frühling ohne Blüten,
sind die Blumen und Früchte ohne Schmelz? Aristoteles
hat der Imagination ein glänzendes Zeugnis ausgestellt,
das um so höher zu werten ist, als er nicht mit ihr begabt war, während sie
seinen Rivalen Plato auszeichnete. Die schönen
Bilder kränken nur den Neid.
- Rivarol, nach (riv)
Bild (21) Zwei
unvergeßliche Fotos von Henry James
sind uns geblieben, die Alice Boughton 1906 aufgenommen hat. Das erste
verewigt das Bild eines herablassenden, leidenden Herrn, der hinter den Attributen
konventioneller Eleganz — Zylinder, steifer Kragen, Spazierstock, auf den er
sich
stützt— vergeblich das zu verbergen sucht, was sein tieftrauriges Gesicht verrät:
daß er der unglücklichste aller Menschen ist. Das zweite zeigt Henry James in
derselben Kleiderpracht, wie er, nicht ohne ungläubige Verblüffung, das erste
Bild betrachtet. Die Idee zu diesem Spiel mit dem Menschen, wie ihn die anderen
sehen und wie er selbst sich sieht, stammt zweifellos von Henry James. Das Gesicht,
das beide Fotos überliefern, entspricht mit seinem stoischen und abwesenden
Ausdruck dem unbeugsamen Bild, das uns aus seinem Werk anblickt.
- J. L. Borges, Nachwort zu Henry James,
Die Freunde der Freunde. Stuttgart 1983.
Die Bibliothek von Babel Bd. 11, Hg. Jorge Luis Borges
Bild (22) Mit den Bildern hielt sie sich die Angreifer nicht bloß vom Leibe. Sie schlug sie damit zurück. Das jeweilige Bild diente ihr ebenso als Rüstung wie auch, sooft es um mehr ging als um friedliches Entwaffnen, als Waffe. Mit den Bildern hatte sie es in der Hand, den anderen buchstäblich niederzumachen und »auszuschalten«. Ohne zu wissen, wie ihm geschah, und ohne von dem Bild etwas mitzubekommen, schlug dieses auf ihn ein, ausgesandt von ihren Brauenbögen oder Schulterblättern, und traf ihn mit der Wucht eines elektrischen Schlags, der ihn durchfuhr von den Fußsohlen hinauf bis in den Scheitel.
So wurde jetzt dem einen Berufsfeind sein Metallkoffer
weggeschmettert durch die Halle, und er taumelte dahinter her. So kam jetzt
von der fortgesetzt auf sie einflüsternden Altweiberstimme in ihrem Rücken ein
Sticklaut, und einen Augenblick später war die Spukfigur mit einem der nadelspitzen
Palmenfächer von Nablus oder Jericho von der Szene gefegt. - Peter Handke, Der Bildverlust.
Frankfurt am Main 2002
Bild (23) Es sagt Mis'ar b.
al-Muhalhil: Das Bild Shabdez ist eine Parasange von der Stadt Karmisin entfernt.
Es ist ein Mann auf einem Pferd aus Stein, angetan mit einem unzerreißbaren
Panzer aus Eisen. Dessen Panzerhemd sichtbar ist. Und mit Buckeln auf dem Panzerhemd.
Ohne Zweifel meint, wer es sieht, daß es sich bewegt.
- (jah)
Bild (24) Das Bild suggeriert
nicht, evoziert nicht: es ist, und zwar mit einer Macht
der Präsenz, die der geschriebene Text nie besitzt, aber einer Präsenz, die
alles Nichtgezeigte ausschließt. Für einen Schriftsteller ist das Wort
vor allem Berührung mit anderen Wörtern, die er nach und nach zur Hälfte weckt:
sobald das Schreiben poetisch genutzt wird, ist es eine Ausdrucksform mit Aura.
Die bloße Tatsache übrigens, daß die Bilder, die es evoziert, in der Phantasie
des Lesers aus einem Wortfluß aufsteigen, der diese Bilder innerviert, aber
nicht einhüllt und konturiert, läßt sie mehr oder weniger in einer dichten,
dem Traum verwandten Irrealität untergehen: die gesamte Sprache - im Zustand
der Übersättigung und bereit, selbst beim leichtesten Zusammenstoß zu Klumpen
zu gerinnen - schwebt, präsent und einberufen, um ein Stück geschriebenen Textes:
das anschauliche Bild hingegen verdrängt alle übrigen und schließt sie aus,
das Bild »rahmt«, wie der Maler sehr wohl weiß, seinen Inhalt in jedem Augenblick
streng ein. - (grac2)
Bild (25) Es war schon
René Descartes bewusst, dass bei der visuellen Wahrnehmung auf der Netzhaut
ein Bild generiert wird. Descartes schloss aus diesem Sachverhalt, dass Menschen
nicht direkt die materielle Welt, sondern innere Bilder wahrnehmen. Der Gegenwartsphilosoph
Lambert Wiesing kommentiert: „Der wahrnehmende Mensch betrachtet immer
schon wie der Besucher einer Camera obscura ausschließlich Bilder, die sich
zwischen ihm und der angeblich gesehenen Welt befinden.“ Nun scheint die Annahme
eines inneren Bildes jedoch nur unproblematisch zu sein, wenn es einen Betrachter
gibt, der dieses Bild anschaut. Unbetrachtete Bilder können schließlich zu keinem
bewussten Wahrnehmungserlebnis führen. Dies ist der Grund, warum viele klassische
Theorien der Wahrnehmung einen Homunculus postulieren. Bei Descartes hatte der
Homunculus die Form eines immateriellen Geistes,
dem an der Epiphyse Informationen über die materielle
Welt präsentiert werden sollten. - Wikipedia
Bild (26) Es gibt Abdrücke von gleicher Gestalt wie die festen Körper, die aber an Feinheit die von uns wahrgenommenen Dinge weit überragen. Denn es ist nicht unmöglich, daß in der Atmosphäre derartige Ablösungen vor sich gehen, und ebensogut können auch Vorkehrungen vorhanden sein für Herstellung der Höhlungen und Verfeinerungen, auch kann es Abflüsse geben, die dieselbe Lage und Abfolge beibehalten, die sich an den festen Dingen selbst zeigte. Diese Abdrücke aber nennen wir Bilder (Idole). Ihre Bewegung durch den leeren Raum bewältigt, da sich ihnen nichts entgegenstellt, was ihren Lauf hemmen könnte, jede erdenkliche Entfernung in einer für unseren Verstand unfaßbar kurzen Zeit. Das Vorhandensein nämlich oder Nichtvorhandensein eines Hemmnisses kommt dem gleich, was man Langsamkeit und Schnelligkeit nennt. Gleichwohl wird nach rein spekulativ festgestellten Zeitbestimmungen ein in Bewegung befindlicher Körper doch nicht zu gleicher Zeit an mehreren Orten ankommen (denn das ist undenkbar), wenn er auch in sinnlich wahrnehmbarer Zeit zugleich ankommt, von welcher Stelle des Unendlichen auch immer er seinen uns nicht erfaßbaren Ausgangspunkt für die Bewegung genommen haben mag. Denn etwas dem Hemmnis Gleichendes wird sich doch einstellen, wenn wir auch bis jetzt die Schnelligkeit der Bewegung als hemmungslos haben gelten lassen. Auch diese grundlegende Lehre ist es nützlich festzuhalten.
Ferner widerstreiten die Tatsachen der sinnlichen Erscheinung durchaus nicht der Annahme, daß die Bilder von einer Feinheit sind, der schlechthin nichts gleichkommt; daher auch ihre unübertreffliche Schnelligkeit, indem sie überall einen für sie passenden Durchgang finden, abgesehen davon, daß ihrem Daherströmen keine oder nur geringe Hindernisse entgegentreten, während sich einer großen oder unendlichen Menge von Atomen alsbald ein Hemmnis entgegenstellt.
Weiter gehört hierher auch der Satz, daß die Entstehung der Bilder sich mit
Gedankenschnelle vollzieht. Denn der Abfluß von der Oberfläche
der Körper geht in stetiger Folge vor sich, ohne sich durch die Minderung kundzugeben,
denn es tritt Ersatz dafür ein; dabei bewahrt das abfließende Bild die Lage
und Ordnung der Atome an dem festen Körper geraume Zeit hindurch, wenn es auch
zuweilen in Verwirrung gerät; auch plötzliche Zusammenziehungen in der Atmosphäre
treten ein, da ja die füllende Körpermasse in der Tiefenrichtung fehlt. Daneben
finden sich auch noch gewisse andere Entstehungsweisen derartiger Naturgebilde.
Denn nichts davon steht in Widerspruch mit den sinnlichen Wahrnehmungen, wenn
man in bestimmter Weise das erscheinende Sinnenobjekt ins Auge faßt, auf das
man denn auch die gleichzeitigen Einwirkungen der äußeren Dinge auf uns beziehen
wird. - Epikur, nach (diol)
Bild (27) Die Atomisten waren
der Meinung, dass sich von den Dingen ohne Un-terlass Atomkonstellationen ablösen,
die als Bilder in die Seele eindringen. Obgleich sie vollkommen recht hatten
und unser gesamtes Denken von der Atomisierung der Dinge bestimmt wird, fand
und findet die atomistische Theorie nicht genügend Beachtung. Je mehr Atome
sich von den Dingen lösen, desto unerkenntlicher werden die Dinge selbst. Schließlich
divergieren die abgeworfenen Bilder in einem solchen Maß von den durch die Abwerfung
veränderten Dingen, dass sie schließlich die Verbindung zu dem sie erzeugenden
Objekt verlieren und außer Kontrolle geraten. So verändert sich durch die sich
von den Dingen lösenden Bilder die Art des Menschen zu denken. Bald ist man
zu Recht der Auffassung, das Ding an sich sei gar nicht mehr zu erkennen, bald
versucht man, überlebte Bilder positivistisch zu restaurieren oder mit Abbildungstheorien
der Sprache zu überfrachten, und schließlich ist man der Auffassung, man befinde
sich unter Simulakra, die auf kein Original mehr verweisen. Die Geschichte der
Philosophie ist somit eine Geschichte des Atomismus. Allein der unglücklich
Liebende weiß, dass sich alles um ihn herum auflöst und zu nicht mehr fassbaren
Punkten zerstäubt. Es handelt sich dabei um kein Trugbild des Herzens, sondern
um den durch den Schmerz der Liebe frei gewordenen und geschärften Blick auf
die Realität. Nicht mehr lange, und ich werde durch Wände gehen. - (raf)
Bild (28) Ihre schöpferischen
Taten verrichten Walanganda und Ungud niemals bei Tag, sondern immer bei Nacht.
Sie weilen dabei im Traumzustand lalai. Ungud verwandelt
sich in diesem Zustand in die Wesen, die er oder sie - Ungud ist je nach Belieben
von dem einen oder anderen Geschlecht oder auch zweigeschlechtlich - erschaffen
will. Ebenso träumt Walanganda die Wesen,
die er erschafft. Walanganda wirft ständig träumend
Seelenkraft vom Himmel herab. Er formt diese Seelenkraft zu Bildern der Geschöpfe,
die er erschaffen möchte. Diese Bilder bringt er mit roter, weißer und zuletzt
mit schwarzer Farbe in allen Ländern an bestimmten Felswänden an. So entstehen
die Felsbilder, die sich im Lande finden, die jeweils die seelischen Zentren
für die Wesen sind, die sie darstellen. Die Bilder an den Felsen verhalten sich
wie Väter und Brüder zu diesen Wesen. Erst nachdem die Seelenkraft der Wesen
in den Bildern Form annimmt, schafft Walanganda die Geschöpfe selbst. Er sendet
sie nach allen Seiten hin über die Erde aus. Walanganda erschafft und träumt
ständig weiter und läßt die Geschöpfe auf der Erde nie aussterben. Unaufhörlich
sendet er neue Seelenkräfte vom Himmel herab. -
Hans-Jürg Braun, Das Jenseits. Die Vorstellungen der Menschheit über
das Leben nach dem Tod. Frankfurt am Main 2000 (it 2516, zuerst 1996)
Bild (29) Er aber war ein Baum, angewurzelt. Seine Wünsche bewegten ihn nicht. Gediehen zu kettenartigen farbig unfruchtbaren Träumen, die seinen Leib träge machten. Er achtete oft tagelang seiner nicht. Füllte ihn an mit Speise und Trank, ohne es zu wissen, schied sich von ihm in Schmerzen und Lüsten, rang sich nicht los von den Bildern seiner inneren Augen, die sich immer prächtiger und unwirklicher auswuchsen. Was ihn umgab, erkannte er nicht mehr. Anders hätte er umkehren müssen von dem Weg, der ihn verhängnisvoll beeinflussen mußte, begann er doch, sich von der Schöpfung abzusondern.
Er sah Ebenen, grobsandig, rot, blau, Kristalle undurchsichtigen Korunds.
Steinerne Hallen wölbten sich. Funkelnde Gläser gaben das Licht, das nicht von
der Sonne kam. Heimliche Kammern bargen unermeßliche Schätze, die er in seine
Hände nahm, die sich ihm zur Freude zusammenstellten zu Zeicheo und Gebilden.
Da gab es einen achtkantigen zweigeschossigen Kuppelbau, der an den Wänden ringsum
mit kupfernen Fächern geteilt war. Aus ihnen entnahm er kleine, winzig kleine
Bilder, die aus Emailleschmelz zusammengeronnen waren zu einer milden Wirklichkeit.
In ihnen fand er, unendlich klein, versteint, erstarrt im Flusse des Materials,
die Menschen, die im Fleisch zu meiden er gelernt hatte, in ihren anmutigsten
Gebärden. Seine Bedürftigkeit zu ihnen trieb ihn, die glatten Glaser zu streicheln.
Und wandte er sich endlich ab, übersättigt, übermüdet von der schweren Arbeit
seines schaffenden Hirns, war es doch keine Umkehr zum Schlaf, zur Arbeit seiner
jungen Fäuste, zur Kraft seines unerlösten Bluts. Er schritt nur behutsam davon,
ihm folgten, ahnte er's auch nur, die Bilder, jetzt lebend, lebend und erwachsen
wie er, Menschen dunkelhäutig und weiß, erregt und ausgeruht, in kostbare Gewänder
gehüllt oder entkleidet, wie er es begehrte. Immer aber voll eines seltsamen
sternenhaften Lebens, das die Wirklichkeit dieser Erde nirgends erfüllen konnte.
An seinen Gesichten mußte Perrudja ein Feind der Menschen werden, weil es zukünftig
nicht geschehen konnte, daß sie mit der Nähe ihres Leibes als ein Bild vor ihn
hinträten, das ihm gefiel. Selbst seine eigene Körperlichkeit wurde ihm fremder
nach und nach. Die Bedürfnisse seiner Existenz wurden ihm widerwärtig, seine
Notdürfte quälten ihn unbegreiflich. Die Herrlichkeit seiner künstlichen Zauberwelten,
die buntschillernd auch in die Phantasien seines Schlafes übergingen, trennte
er von den Trieben seiner Jahre. Er kämpfte nicht mehr mit ihnen, er befriedigte
sie, um sie zum Schweigen zu bringen. So wurde er, trotz der kaum noch versteckten
Abneigung gegen seinen Leib, unmäßig in allem. Und die spielenden Bewegungen
seines Körpers verstummten. Als Rache für die Mißachtung legte sich, trotz seiner
Jugend, ein leichter Fettansatz um seinen Bauch. Die Augen wurden klein, müde,
umschattet. Als er eines Tages die Veränderung an sich gewahrte, begann er sich
zu schämen. Aß nicht, hungerte. Badete in eiskaltem Wasser, schleppte Steine,
bewegte seine Glieder bis zur Erschöpfung, knetete mit geballten Fäusten das
Fett an seinen Muskeln, schrie. - Hans Henny Jahnn, Perrudja. Frankfurt
am Main 1966 (zuerst 1929)
Bild (30)
Bild (31) So wie jeder irgendein Bild von New York habe oder Los Angeles, so habe eben jeder auch ein Bild von sich selbst, und die Qual des Lebens bestehe eben darin, diesem Bild nicht zu entsprechen. Für manche bestehe die Qual des Lebens noch zusätzlich darin, die Bilder fremder Städte niemals mit dem Original abgleichen zu können. Obwohl es diese Qual tatsächlich kaum noch für jemanden gebe. Dafür sei die Entfernung, gleichermaßen wie das Reisen, zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Ebenso verhalte es sich übrigens generell im gesellschaftlichen Umfeld, denn entweder sei etwas Qual oder bedeutungslos. Wobei es verwunderlich sei, daß man allerorts und wie besessen Zustände anstrebe, wo Zustände doch immer nur Lähmung und Gipsbett seien, während Bewegung sich allein im Verlassen von Zuständen finde, in der Bewegung weg von der Qual hin zur Bedeutungslosigkeit und dann wieder umgekehrt, obwohl das natürlich auch nicht ewig so weitergehe, denn dann wäre diese Bewegung wieder ein Zustand und damit entweder Qual oder bedeutungslos.
Um diesen sich gegenseitig ablösenden Zuständen der Lähmung zu entkommen,
habe der Mensch die Bilder erfunden, und mit dem Abgleichen
dieser Bilder halte er sich auf Trab. -
(rev)
Bild (32) Myriaden
sie in einem fort streifender, auf sie einstürzender, in ihr aufschießender,
durch sie hindurch aufleuchtender, sie wachkitzelnder Bilder während jener Alleinfahrt.
Gleich innen wie außen, hoch oben wie tief unten, in der Waagrechten wie in
der Senkrechten. Und ein jedes der Bilder, wenn auch nach einer Mikrosekunde
wieder ausgeknipst und höchstens noch ein wenig nachflimmernd, faßbar und sowohl
den Sinnen als auch dem Verstand zugänglich, gleichermaßen nachzuschmecken und
auf eine klare Gedankenbahn zu bringen; ein jedes, wenngleich umgeben, wie jetzt,
und unterlegt von dem Schein der versäumten Dauer, ein Schatz,
der nicht verlorengehen würde, auch wenn man das jeweilige Bild
ohne besonderes Schmecken und Bedenken wieder verschwinden ließ, und der an
Wert - sie kannte sich ja aus mit den »Werten« - alles übertraf, was man im
Leben überhaupt je »haben« oder »sein Eigen« nennen konnte. - Peter Handke,
Der Bildverlust. Frankfurt am Main 2002
Bild (33) Die Gewalt des Bildes
(und allgemeiner der Information und des Virtuellen)
besteht darin, daß es das Reale umbringt. Alles muß gesehen
werden, alles muß sichtbar sein. Das Bild ist der
Ort dieser Sicherheit par excellence. - Jean Baudrillard, Der Geist des
Terrorismus. Nach (jir)
Bild (34) Lange
vor Aristoteles bezeichnete das Wort ,Idee'
bei den Griechen eigentlich ein Bild, und daher kommt auch das Wort ,Idol'.
Aristoteles prüfte jede seiner Ideen und erkannte, daß tatsächlich alle aus
einem Bild hervor-gingen, das heißt aus einem Sinneseindruck. Daraus ergibt
sich, daß selbst das erfinderischste Genie nichts völlig Neues erfinden kann.
Die Schöpfer der Mythologie ver-banden Kopf und Brust eines Mannes mit dem Leib
eines Pferdes, den Leib einer Frau mit dem Schwanz eines Fisches. Sie nahmen
dem Zyklopen ein Auge, gaben dem Briareos zusätzliche Arme, doch sie erfanden
nichts, denn das liegt nicht in der Macht des Menschen. Und seit Aristoteles
steht fest, daß es nichts im Denken gibt, was nicht vorher in den Sinnen gewesen
ist. - (sar)
Bild (35)
Bild (36)


 |
||
 |
||
 |
 |
|
 |
||


 |
||
   |
  |
|
|
|
||