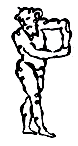 olytheismus
Ich halte es für ein Zeichen menschlicher Schwäche, das Bild
und die Gestalt Gottes zu erforschen. Wer auch Gott
ist, wenn es noch einen gibt und wo er sich befindet, so ist er ganz Sinn,
Gesicht, Gehör, Seele, Geist
und ganz er selbst. Aber an unzählige Götter glauben und sogar nach den
Tugenden und Lastern der Menschen an einen Gott der Schamhaftigkeit, Eintracht,
Klugheit, Hoffnung,
Ehre, Milde, Treue, oder (wie Demokrit
sagt) an zwei, ein Wesen der Bestrafung und Belohnung,
zeugt von einem noch größeren Unverstande. Die gebrechlichen und mühseligen
Menschen haben, ihrer Schwachheit eingedenk, die Gottheit in Teile geteilt,
damit ein jeder den Teil verehre, dessen er am meisten bedarf. Daher finden
wir bei andern Völkern andere Namen von zahllosen Göttern; auch sind unterirdische
Dinge, Krankheiten und viele böse Seuchen in Gattungen geteilt, weil wir
sie in zagender Furcht besänftigt wissen möchten.
olytheismus
Ich halte es für ein Zeichen menschlicher Schwäche, das Bild
und die Gestalt Gottes zu erforschen. Wer auch Gott
ist, wenn es noch einen gibt und wo er sich befindet, so ist er ganz Sinn,
Gesicht, Gehör, Seele, Geist
und ganz er selbst. Aber an unzählige Götter glauben und sogar nach den
Tugenden und Lastern der Menschen an einen Gott der Schamhaftigkeit, Eintracht,
Klugheit, Hoffnung,
Ehre, Milde, Treue, oder (wie Demokrit
sagt) an zwei, ein Wesen der Bestrafung und Belohnung,
zeugt von einem noch größeren Unverstande. Die gebrechlichen und mühseligen
Menschen haben, ihrer Schwachheit eingedenk, die Gottheit in Teile geteilt,
damit ein jeder den Teil verehre, dessen er am meisten bedarf. Daher finden
wir bei andern Völkern andere Namen von zahllosen Göttern; auch sind unterirdische
Dinge, Krankheiten und viele böse Seuchen in Gattungen geteilt, weil wir
sie in zagender Furcht besänftigt wissen möchten.
So hat man auf dem palatinischen Berge einen Tempel des Fiebers, einen
Tempel der Laren, einen Altar für die Orbona und für das böse Geschick
einen auf dem exquilinischen Hügel eingeweiht. Die Zahl der Götter muß
größer als die der Menschen ausfallen, weil ein jeder für sich so viele
Götter macht, indem er sich eine Juno oder einen
Genius wählt. Gewisse Völker aber halten Tiere und sogar schmutzige, desgleichen
viele Dinge, die ich mich zu nennen schäme, für Götter und schwören bei
stinkenden Speisen und ähnlichen Sachen. Daß man aber glaubt, unter den
Göttern fänden Ehen statt, aus welchen in langer Zeit keine Kinder geboren
würden; ferner, einige von ihnen wären sehr alt und immer Greise, andere
Jünglinge und Knaben, von schwarzer Farbe, geflügelt, lahm, aus einem Eie
gekommen, abwechselnd einen Tag lebendig und tot, das grenzt an kindischen
Wahnsinn. Allein alle Unverschämtheit übersteigt
es, wenn man Ehebruch, Zank, Haß unter ihnen, ja
sogar Gottheiten des Diebstahls und der Verbrechen annimmt. - (pli)
Polytheismus (2) Demokritus,
Orpheus und viele Pythagoräer, welche die Kräfte
der Gestirne und die Eigenschaften der Dinge unserer
Welt aufs Sorgfältigste untersuchten, haben die durchaus nicht ungereimte Behauptung
aufgestellt, daß alles voll Götter sei. Keine Sache
besitzt nämlich so vortreffliche Kräfte, daß sie, wenn ihr die göttliche Hilfe
mangelte, durch sich selbst bestehen könnte. Götter aber hießen sie die den
Dingen innewohnenden göttlichen Kräfte, welche Zoroaster göttliche Anlocker,
Synesius symbolische Reize, andere Leben und noch andere Seelen nannten.
- (nett)
Polytheismus (3, indischer) Alle
diese Geschöpfe leben in Welten für sich unter eigenen Königen
oder kommen nebeneinander in der Welt der Menschen vor. Der immer anthropomorph
gedachte Götterkönig oder »König der 30 (32) Götter«,
der Himmelsgott Indra, der seinen diamantenen Donnerkeil (wadschra) als furchtbare
Waffe führt, ist in alter Zeit der Fürst des Himmels. In späterer
Zeit treten bei den Brahmanen über ihn das personifizierte Abstraktum Brahman
(Himmelsfeuer) als persönlicher Gott und Schöpfer, Wischnu als Erhalter,
Schiwa als Vernichter und Herr des Zaubers, dem die Krieger und die Räuber,
die Hexen und Zauberer huldigen. Bei den Dschaina werden die 24 Propheten oder
Dschina (Arhat) vergöttlicht und in späterer Zeit als die »Obergötter«
betrachtet, denen alle anderen untergeordnet sind1. Der König der Vögel
ist der göttliche Adler Garuda, später als Wischnus Reittier gedacht,
der König der Vierfüßler je nach den verschiedenen Gegenden
Indiens der Löwe oder der Tiger, der König der Pflanzen in wedischer
Zeit der Söma, das Kraut, aus welchem zu Opferzwecken der Unsterblichkeitstrank
gebraut wurde. Das Gefäß, in dem dieser indische »Nektar«
- in späterer Zeit Amrita, »Unsterblichkeit«, genannt - bei
den Göttern aufbewahrt wird, ist der Mond, der oft mit ihm unmittelbar
identifiziert und ebensooft zugleich persönlich gedacht wird. Denn die
Inder haben die den alten Indogermanen überhaupt eignende merkwürdige
Gabe, sich personifizierte Naturkräfte zugleich in ihrer elementaren und
in ihrer vermenschlichten Gestalt vorzustellen, während es andererseits
auch zahlreiche Stellen in der Literatur gibt, die von Verwandlungen aus der
einen in die andere Gestalt sprechen.
Einige Beispiele für die höheren Wesen, welche nach indischem Glauben
die Welten bevölkern, seien hier angeführt.
Himmel (Winatā in Gestalt eines weiblichen Adlers), Erde (Kadru in Gestalt
einer weiblichen Schlange), Feuer (Agni), Sonne (Surja), Mond (Tschandra), Morgenrot
(Aruna), Wolke (Pardschanja), Winde (Marut); Flüsse (Apsaras, zugleich
Götterhetären am Hofe Indras), namentlich die Gangā, der Strom, der
aus der Welt der Götter, in der man sie als Milchstraße sieht, auf
Schiwas Haupt herabfällt und von da aus durch die Welt der Menschen in
die Unterwelt strömt; das Meer; der Himalaja, dessen Tochter Durga, die
mit blutigen Opfern verehrte Göttin, Schiwas Gemahlin ist; Bäume (der
Rauhina im Sauparna), die Wunschbäume und Wunschlianen in Nandana, dem
Park Indras, gelegentlich aber auch auf der Erde, welche alle an sie gerichteten
Bitten erfüllen, wie unter den Steinen die Wunschedelsteine; Tiere: die
Kuh, die überall in Indien als heiliges Wesen gilt und in der Wunschkuh
Surabhi und den anderen alle Wünsche gewährenden Wunschkühen
ihre edelste Gestalt erreicht; die acht Weltelefanten, welche die Haupt- und
Nebenhimmelsgegenden bewachen: der Reiher Nādidschangha; der Rischi Tārkschja,
ein Vogel; der Adler Garuda, der die Schlangen vertilgt, Frösche, Schlangen,
sowohl die himmlischen als die aus der Unterwelt auf die Erde emporsteigenden.
Alle diese dämonischen Tiere können Menschengestalt annehmen. Unter
den Gestalten, in denen Wischnu die Welt erlöste, befinden sich die tierischen
des Fischs, der Schildkröte, des Ebers und des Schimmels. In einer anderen
Verkörperung tritt er als Mischgestalt halb Mensch, halb Löwe, auf,
wie die die Gebirge bevölkernden Kimpuruscha oder Kinnara als Wesen gedacht
werden, die Roßköpfe auf Menschenleibern tragen. Außer dem
bereits genannten, zum obersten brahmanischen Gott erhöhten Abstraktum
Brahman gibt es noch andere Abstrakta, welche als Götter und Göttinnen
gedacht werden und jederzeit Menschengestalt annehmen können: z. B. Watsch,
die Rede, die als Hymnus - Gebet oder Zauber - die Götter zum Geben zwingt,
als Fluch, namentlich aus dem Munde eines Brahmanen,
zu unfehlbarem Verderben führt. Die Segens- und Fluchformeln sind dem Inder
noch heute nicht zu bloßen Höflichkeitsphrasen oder Interjektionen
des Ärgers verblaßt, wie dem Europäer,
sondern haben Zauberwirkung. Wie in der Surā-Geschichte der Siegeswunsch zum
wirklichen Siege führt, so siegt in wedischer Zeit Indra durch den Siegeswunsch
und Lobpreis der Windgötter. Niemand denkt sich bei uns mehr etwas dabei,
wenn er einem Niesenden »Gesundheit!« zuruft. Der Inder, der in
gleichem Falle »dschīwa!« (»lebe!«) ruft, weiß,
daß er damit verhindert, daß dem Niesenden der Lebenshauch aus der
Nase fährt. Die Metren erscheinen in Garuda verkörpert, z. B. im Sauparna.
Ebenso erscheinen als Göttinnen oder Götter in Menschengestalt irgendwelche
Zauber, besonders die Widjā, »Wissen«, d. h. bestimmte als Göttinnen
gedachte Zauber, durch deren Besitz man zu einer Art göttlichen Wesens,
Widjadhara oder »Wissensträger«, mit übernatürlichen
Fähigkeiten wird, das Glück (die Göttin Lakschmi, auch = Reichtum
und Herrschaft), das Bhagja (die Folge guter Taten in einem früheren Dasein).
Im Rigweda finden sich zwei Hymnen, die an den »Zorn«
gerichtet sind. Wie die eben genannten Widjadhara durch den Besitz der Widja,
die man sich durch besondere Zeremonien noch aneignen (sadh) muß, zu göttlichen
Wesen geworden sind, so erlangen die Jogin, meist schiwaitische Asketen,
durch Zauber übernatürliche Kräfte. Der Zauber
spielt in Indien überhaupt eine große Rolle; wer die verschiedenen
Geheimwissenschaften studiert, vermag sich zum Herrn der Menschen wie höhere
Wesen zu machen. Häufig erwähnt wird die namentlich durch Zauber bewirkte
Herstellung eines goldenen Mannes, dessen abgeschnittene Glieder sich immer
wieder ergänzen, wie man sich andererseits durch eine alchimistische Flüssigkeit
Gold verschaffen kann. Durch Zauberpillen und magische Stirnzeichen vermag man
seine Gestalt zu verwandeln. Dem Schiwa und seiner
Gemahlin Durga (DewI, Bhattarika), deren Tempel auf den von allem Spuk umgebenen
Verbrennungsplätzen stehen, welche zugleich Richtstätten und oft im
Walde gelegen sind (»Väterhaine«, d. h. Ahnenhaine), huldigen
auch die Hexen, die die übernatürliche Macht, die sie besitzen, namentlich
dem Genuß von Menschenfleisch verdanken.
Sie suchen darum nächtlicherweile die Verbrennungsplätze auf und verzehren
die Leichen oder wissen sich auf andere Weise Menschenfleisch
zu verschaffen. Weiter gewinnt man übernatürliche Kräfte durch
strenge Askese, und ganz allgemein als Götter,
die auf Erden wandeln, als »Erdengötter« (bhudewa) werden die
Brahmanen bezeichnet. Der jeweilige Oberpriester der verschiedenen wischnuistischen
Sekten gilt als Inkarnation Wischnus. Sonst genießen nur der König
und die Königin göttliche Ehren, indem man sie mit dewa, »Gott«,
und dewi, »Göttin«, anredet, was wir nach altem Herkommen abschwächend
mit »Majestät« übersetzen. Zauberzeremonien
sind die Opfer, durch die man die Götter in seine Dienste zwingt, seine
Gegner vernichten und alles erreichen kann, was man will.
Unter den Dämonen sind besonders die Rākschasa
(fem. RākschasĪ) zu nennen, welche teils eigene Staaten bewohnen, teils in der
Menschenwelt und meist nächtlicherweile ihren Spuk treiben und sich von
Menschenfleisch nähren, auf menschliche Frauen lüstern sind, in ihrer
weiblichen Form auch die Pest verursachen und Schwangeren gefährlich werden,
wie andere Dämonen die Menschen durch andere Krankheiten schädigen
und die Empfängnis verhindern; niedere Götter sind die Jakscha, welche
sich die brahmanischen Inder als Diener Kuberas, des Gottes des Reichtums, denken,
während sie bei den Dschaina ohne diese Beschränkung oft als Schutzgottheiten
von Dörfern und Städten, aber auch als Diener der Dschina erscheinen.
Die Dämonen hausen namentlich gern auf Feigenbäumen
(njagrōdha, vata, pippala), besonders wenn diese auf Leichenverbrennungsplätzen
stehen. - Nachwort zu: Indische Märchen. Hg. und Übs.
Johannes Hertel, München 1953 (Diederichs, Märchen der
Weltliteratur)
Polytheismus (4) Daß
der einzelne sich sein eigenes Ideal aufstelle und aus ihm sein Gesetz,
seine Freuden und seine Rechte ableite — das galt wohl bisher als die ungeheuerlichste
aller menschlichen Verirrungen und als die Abgötterei an sich: in der Tat
haben die wenigen, die dies wagten, immer vor sich selber eine Apologie nötig
gehabt, und diese lautete gewöhnlich: „Nicht ich! nicht ich! sondern ein
Gott durch mich!" Die wundervolle Kunst und Kraft, Götter
zu schaffen — der Polytheismus — war es, in der dieser Trieb sich entladen
durfte, in der er sich reinigte, vervollkommnete, veredelte: denn ursprünglich
war es ein gemeiner und unansehnlicher Trieb, verwandt dem Eigensinn, dem Ungehorsam
und dem Neide. Diesem Triebe zum eigenen Ideal feind sein: das war ehemals das
Gesetz jeder Sittlichkeit. Da gab es nur eine Norm: „der Mensch" — und
jedes Volk glaubte diese eine und letzte Norm zu haben. Aber über
sich und außer sich, in einer fernen Überwelt, durfte man eine Mehrzahl
von Normen sehen: der eine Gott war nicht die Leugnung oder Lästerung
des anderen Gottes! Hier erlaubte man sich zuerst Individuen, hier ehrte man
zuerst das Recht von Individuen. Die Erfindung von Göttern, Heroen und
Übermenschen aller Art, sowie von Neben- und Untermenschen, von Zwergen,
Feen, Zentauren, Satyrn, Dämonen und Teufeln war die unschätzbare
Vorübung zur Rechtfertigung der Selbstsucht und Selbstherrlichkeit des
einzelnen: die Freiheit, welche man dem Gotte gegen die anderen Götter
gewährte, gab man zuletzt sich selber gegen Gesetze und Sitten und Nachbarn.
Der Monotheismus dagegen, diese starre Konsequenz
der Lehre von einem Normalmenschen — also der Glaube an einen Normalgott, neben
dem es nur noch falsche Lügengötter gibt - war vielleicht die größte
Gefahr der bisherigen Menschheit: da drohte ihr jener vorzeitige Stillstand,
welchen, soweit wir sehen können, die meisten anderen Tiergattungen schon
längst erreicht haben; als welche alle an Ein Normaltier und Ideal in ihrer
Gattung glauben und die Sittlichkeit der Sitte sich endgültig in Fleisch
und Blut übersetzt haben. Im Polytheismus lag die Freigeisterei und Vielgeisterei
des Menschen vorgebildet: die Kraft, sich neue und eigene Augen zu schaffen
und immer wieder neue und noch eigenere: so daß es für den Menschen
allein unter allen Tieren keine ewigen Horizonte und Perspektiven gibt. Friedrich
Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft
Polytheismus (5) Zu einem
griechischen Polytheismus gehört viel Geist; es ist freilich sparsamer
mit dem Geist umgegangen, wenn man nur einen Gott hat - Friedrich Nietzsche, Notizen zu Unzeitgemäße Betrachtungen
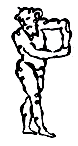 olytheismus
Ich halte es für ein Zeichen menschlicher Schwäche, das Bild
und die Gestalt Gottes zu erforschen. Wer auch Gott
ist, wenn es noch einen gibt und wo er sich befindet, so ist er ganz Sinn,
Gesicht, Gehör, Seele, Geist
und ganz er selbst. Aber an unzählige Götter glauben und sogar nach den
Tugenden und Lastern der Menschen an einen Gott der Schamhaftigkeit, Eintracht,
Klugheit, Hoffnung,
Ehre, Milde, Treue, oder (wie Demokrit
sagt) an zwei, ein Wesen der Bestrafung und Belohnung,
zeugt von einem noch größeren Unverstande. Die gebrechlichen und mühseligen
Menschen haben, ihrer Schwachheit eingedenk, die Gottheit in Teile geteilt,
damit ein jeder den Teil verehre, dessen er am meisten bedarf. Daher finden
wir bei andern Völkern andere Namen von zahllosen Göttern; auch sind unterirdische
Dinge, Krankheiten und viele böse Seuchen in Gattungen geteilt, weil wir
sie in zagender Furcht besänftigt wissen möchten.
olytheismus
Ich halte es für ein Zeichen menschlicher Schwäche, das Bild
und die Gestalt Gottes zu erforschen. Wer auch Gott
ist, wenn es noch einen gibt und wo er sich befindet, so ist er ganz Sinn,
Gesicht, Gehör, Seele, Geist
und ganz er selbst. Aber an unzählige Götter glauben und sogar nach den
Tugenden und Lastern der Menschen an einen Gott der Schamhaftigkeit, Eintracht,
Klugheit, Hoffnung,
Ehre, Milde, Treue, oder (wie Demokrit
sagt) an zwei, ein Wesen der Bestrafung und Belohnung,
zeugt von einem noch größeren Unverstande. Die gebrechlichen und mühseligen
Menschen haben, ihrer Schwachheit eingedenk, die Gottheit in Teile geteilt,
damit ein jeder den Teil verehre, dessen er am meisten bedarf. Daher finden
wir bei andern Völkern andere Namen von zahllosen Göttern; auch sind unterirdische
Dinge, Krankheiten und viele böse Seuchen in Gattungen geteilt, weil wir
sie in zagender Furcht besänftigt wissen möchten.










