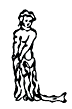 iebschaft
Bis zu meinem zwölften Lebensjahr kann ich mich keiner Liebschaft
entsinnen, außer meiner Zuneigung für ein kleines Mädchen
namens Carmen, dem ich durch einen jüngeren Gefährten einen Brief
zustellen ließ, darin ich ihm meine Liebe
erklärte. Unter Berufung auf diese Liebe bat ich sie, mir ein
Rendezvous zu gewähren. Mein Brief war ihr frühmorgens auf dem
Schulweg übergeben worden. Die Erkorene war das einzige Mädchen,
das mir glich, weil sie reinlich war und in Begleitung einer
kleinen Schwester, wie ich mit meinem kleinen Bruder, zur Schule
ging. Damit diese beiden Zeugen reinen Mund hielten, faßte ich
den Plan, sie sozusagen mit-einander zu verheiraten. Ich legte
also meinem Brief im Namen meines Bruders, der des Schreibens
noch unkundig war, einen anderen an Fräulein Fauvette bei. Meinem
Bruder erklärte ich, daß ich mich zum Vermittler für ihn gemacht
hätte, und wie gut wir es getroffen hätten, gerade an zwei Schwestern
unseres Alters zu geraten, die noch dazu so ausgefallene Vornamen
trügen. Daß ich mich über Carmens Wohlerzogenheit nicht getäuscht
hatte, sollte ich zu meinem Leidwesen noch am gleichen Tage erfahren,
als ich nach dem Mittagessen mit meinen Eltern, die mich verwöhnten
und mir alles durchgehen ließen, wieder in die Schule zurückkehrte.
iebschaft
Bis zu meinem zwölften Lebensjahr kann ich mich keiner Liebschaft
entsinnen, außer meiner Zuneigung für ein kleines Mädchen
namens Carmen, dem ich durch einen jüngeren Gefährten einen Brief
zustellen ließ, darin ich ihm meine Liebe
erklärte. Unter Berufung auf diese Liebe bat ich sie, mir ein
Rendezvous zu gewähren. Mein Brief war ihr frühmorgens auf dem
Schulweg übergeben worden. Die Erkorene war das einzige Mädchen,
das mir glich, weil sie reinlich war und in Begleitung einer
kleinen Schwester, wie ich mit meinem kleinen Bruder, zur Schule
ging. Damit diese beiden Zeugen reinen Mund hielten, faßte ich
den Plan, sie sozusagen mit-einander zu verheiraten. Ich legte
also meinem Brief im Namen meines Bruders, der des Schreibens
noch unkundig war, einen anderen an Fräulein Fauvette bei. Meinem
Bruder erklärte ich, daß ich mich zum Vermittler für ihn gemacht
hätte, und wie gut wir es getroffen hätten, gerade an zwei Schwestern
unseres Alters zu geraten, die noch dazu so ausgefallene Vornamen
trügen. Daß ich mich über Carmens Wohlerzogenheit nicht getäuscht
hatte, sollte ich zu meinem Leidwesen noch am gleichen Tage erfahren,
als ich nach dem Mittagessen mit meinen Eltern, die mich verwöhnten
und mir alles durchgehen ließen, wieder in die Schule zurückkehrte.
Kaum hatten meine Kameraden an ihren Pulten Platz genommen,
während ich noch vor einem Wandschrank hockte, um in meiner Eigenschaft
als Primus die Bücher zum Vorlesen herauszuholen, als der Direktor
eintrat. Die Schüler erhoben sich. Er hielt einen Brief in der
Hand. Mir wurde weich in den Knien, die Bücher fielen zu Boden,
und während ich sie wieder zusammensuchte, sprach der Direktor
mit dem Lehrer. Die Schüler in den ersten Bänken mußten wohl
meinen Namen flüstern hören, denn schon drehten sie sich nach
mir um, der ganz von Purpur übergossen im Hintergrund des Klassenzimmers
stand. Endlich rief der Direktor mich zu sich, und um mich auf
eine ausgesuchte Weise zu strafen, ohne, wie er meinte, meine
Mitschüler dabei auf schlechte Gedanken zu bringen, gratulierte
er mir, einen Brief von zwölf Zeilen ohne einen ein-zigen Fehler
geschrieben zu haben. Er fragte mich, ob ich ihn auch wirklich
allein geschrieben hätte, dann befahl er mir, ihm auf sein Zimmer
zu folgen. Wir begaben uns aber nicht dorthin. Er kanzelte mich
draußen im Hof ab, im strömenden Regen. Was meine moralischen
Begriffe ziemlich durcheinander brachte, war der Umstand, daß
er es für ein ebenso strafwürdiges Vergehen erachtete, das junge
Mädchen (dessen Eltern ihm meine Liebeserklärung zugestellt hatten)
kompromittiert, wie einen Bogen Briefpapier entwendet zu haben.
Er drohte mir, das Blatt meinen Eltern zu schicken. Ich bat ihn
flehentlich, dies nicht zu tun. Er gab nach, sagte jedoch, er
werde den Brief aufheben und bei dem ersten Rückfall nicht umhinkönnen,
meine Eltern von dem anstößigen Betragen ihres Sohnes zu unterrichten.
- Raymond Radiguet, Den Teufel im Leib. Frankfurt am Main
1959 (Fischer-Tb. 251, zuerst 1923)
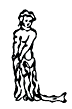 iebschaft
Bis zu meinem zwölften Lebensjahr kann ich mich keiner Liebschaft
entsinnen, außer meiner Zuneigung für ein kleines Mädchen
namens Carmen, dem ich durch einen jüngeren Gefährten einen Brief
zustellen ließ, darin ich ihm meine Liebe
erklärte. Unter Berufung auf diese Liebe bat ich sie, mir ein
Rendezvous zu gewähren. Mein Brief war ihr frühmorgens auf dem
Schulweg übergeben worden. Die Erkorene war das einzige Mädchen,
das mir glich, weil sie reinlich war und in Begleitung einer
kleinen Schwester, wie ich mit meinem kleinen Bruder, zur Schule
ging. Damit diese beiden Zeugen reinen Mund hielten, faßte ich
den Plan, sie sozusagen mit-einander zu verheiraten. Ich legte
also meinem Brief im Namen meines Bruders, der des Schreibens
noch unkundig war, einen anderen an Fräulein Fauvette bei. Meinem
Bruder erklärte ich, daß ich mich zum Vermittler für ihn gemacht
hätte, und wie gut wir es getroffen hätten, gerade an zwei Schwestern
unseres Alters zu geraten, die noch dazu so ausgefallene Vornamen
trügen. Daß ich mich über Carmens Wohlerzogenheit nicht getäuscht
hatte, sollte ich zu meinem Leidwesen noch am gleichen Tage erfahren,
als ich nach dem Mittagessen mit meinen Eltern, die mich verwöhnten
und mir alles durchgehen ließen, wieder in die Schule zurückkehrte.
iebschaft
Bis zu meinem zwölften Lebensjahr kann ich mich keiner Liebschaft
entsinnen, außer meiner Zuneigung für ein kleines Mädchen
namens Carmen, dem ich durch einen jüngeren Gefährten einen Brief
zustellen ließ, darin ich ihm meine Liebe
erklärte. Unter Berufung auf diese Liebe bat ich sie, mir ein
Rendezvous zu gewähren. Mein Brief war ihr frühmorgens auf dem
Schulweg übergeben worden. Die Erkorene war das einzige Mädchen,
das mir glich, weil sie reinlich war und in Begleitung einer
kleinen Schwester, wie ich mit meinem kleinen Bruder, zur Schule
ging. Damit diese beiden Zeugen reinen Mund hielten, faßte ich
den Plan, sie sozusagen mit-einander zu verheiraten. Ich legte
also meinem Brief im Namen meines Bruders, der des Schreibens
noch unkundig war, einen anderen an Fräulein Fauvette bei. Meinem
Bruder erklärte ich, daß ich mich zum Vermittler für ihn gemacht
hätte, und wie gut wir es getroffen hätten, gerade an zwei Schwestern
unseres Alters zu geraten, die noch dazu so ausgefallene Vornamen
trügen. Daß ich mich über Carmens Wohlerzogenheit nicht getäuscht
hatte, sollte ich zu meinem Leidwesen noch am gleichen Tage erfahren,
als ich nach dem Mittagessen mit meinen Eltern, die mich verwöhnten
und mir alles durchgehen ließen, wieder in die Schule zurückkehrte.










