
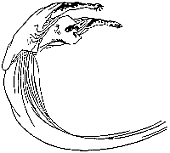 himäre
Zum ersten
Male ist die Chimaira im sechsten Gesang der Ilias erwähnt. Dort
steht geschrieben, daß sie von göttlicher Herkunft, vorn ein
Löwe, in der Mitte eine Geiß und hinten ein Drache war; Feuer
lohte aus ihrem Rachen, und sie wurde getötet von dem schönen
Bellerophon, dem Sohne des Glaukos, wie die Götter es vorausgesagt hatten.
himäre
Zum ersten
Male ist die Chimaira im sechsten Gesang der Ilias erwähnt. Dort
steht geschrieben, daß sie von göttlicher Herkunft, vorn ein
Löwe, in der Mitte eine Geiß und hinten ein Drache war; Feuer
lohte aus ihrem Rachen, und sie wurde getötet von dem schönen
Bellerophon, dem Sohne des Glaukos, wie die Götter es vorausgesagt hatten.
Löwenkopf, Ziegenbauch und Schlangenschwanz - das ist die natürlichste Auslegung der Worte Homers, aber die Theogonie des Hesiod beschreibt sie als ein Ungeheuer mit drei Köpfen, und so ist sie auch auf der berühmten Bronzefigur von Arezzo aus dem 5. Jahrhundert dargestellt. Mitten auf dem Rücken befindet sich der Ziegenkopf, an einem Ende derjenige der Schlange und am anderen der des Löwen.
Im sechsten Gesang der Aeneis erscheint wiederum "die flammenbewaffnete Chimaera"; der Kommentator Servius Honoratus bemerkte, daß nach Meinung aller Autoritäten das Ungeheuer aus Lykien stamme, und daß es in dieser Gegend einen Vulkan gebe, der seinen Namen trägt. Der Fuß des Berges sei von Schlangen verseucht, an den Hängen gebe es Weiden und Ziegen, der Gipfel speie Flammen, und Löwen hätten dort ihr Lager; die Chimaira wäre eine Art Metapher dieses seltsamen Berges.
Vorher
hatte Plutarch erklärt, Chimaira sei der Name eines
Piratenkapitäns, der sein Schiff mit einem Löwen, einer Ziege und
einer Schlange hatte bemalen lassen. Diese absurden Vermutungen beweisen,
daß die Chimaira die Menschen bereits langweilte. Besser als sie sich
vorzustellen war es, sie auf irgend etwas anderes zu übertragen. Sie
war allzu heterogen; der Löwe, die Ziege und die Schlange (in manchen
Texten ein Drache) verweigerten sich der Bildung eines einzigen Tieres. Mit
der Zeit wurde die Chimaira zum 'Chimärischen'; die berühmte
Scherzfrage Rabelais', ("Ob eine Chimäre, die im Leeren schaukelt,
Hintergedanken fressen kann") bezeichnet deutlich die Wandlung. Die
zusammenhanglose Figur verschwindet, und das Wort bleibt, um das Unmögliche
zu beschreiben. "Trugbild, Hirngespinst" ist die Definition, die heute das
Lexikon für das Wort Chimäre gibt. - (bo)
Orthodoxe Darwinisten glauben, die Evolution schreite in gleichmäßiger Kontinuität fort. Jede Generation unterscheide sich unmerklich von der ihrer Eltern, und wenn die Unterschiede sich häuften, kreuze die Spezies eine genetische »Wasserscheide«, und es entstehe ein neues Lebewesen, eines neuen Linnéschen Namens würdig.
Die »Springer« dagegen bestehen darauf - ausgehend von den brutalen Veränderungen im zwanzigsten Jahrhundert —, daß jede Spezies eine Entität mit einem abrupten Anfang und einem abrupten Ende sei und daß die Evolution in kurzen explosionsartigen Tumulten fortschreite, denen lange Perioden der Muße folgten.
Die meisten Evolutionisten glauben, daß das Klima ein Motor evolutionärer Veränderungen sei.
Die Arten sind im großen und ganzen konservativ und widerstehen Veränderungen. Wie Partner in einer nicht mehr intakten Ehe machen sie immer weiter, machen hier und da kleinere Zugeständnisse, bis es zum Ausbruch kommt, über den hinaus sie sich nicht mehr verständigen können.
Bei einer Klimakatastrophe, bei der ihr Habitat in alle Richtungen versprengt wird, kann eine kleine Brutgemeinschaft von ihren Artgenossen getrennt werden und in einer isolierten Nische landen, meistens am äußersten Rand des Gebiets ihrer Vorfahren, wo sie sich verwandeln oder aussterben muß.
Der »Sprung« von einer Spezies zur nächsten geschieht, wenn er erfolgt, schnell und säuberlich. Plötzlich reagieren die Neuankömmlinge nicht mehr auf die alten Lockrufe. Sobald diese »Vereinzelungsmechanismen« eingefahren sind, kann es keine genetische Umkehr mehr geben, keine Auf gäbe neuerworbener Eigenschaften, keinen Weg zurück.
Manchmal können die neuen Arten, durch die Veränderung gestärkt, ihre früheren Lager wieder besiedeln und ihre Vorgänger verdrängen.
Der Prozeß des »Springens« in der Vereinzelung ist »allopatrische Artenbildung« (Artenbildung »in einem anderen Land«) genannt worden und erklärt, warum, während Biologen zahllose Varianten — Körperumfang oder Pigmentierung - innerhalb einer Spezies entdecken, noch nie eine Zwischenform zwischen einer Spezies und der nächsten gefunden wurde.
Das Forschen nach der Abstammung des Menschen mag sich demnach als Jagd auf
eine Chimäre herausstellen. - (chatw)
-
(garten)
Chimäre (4) Die Impotenz ist die
Grundlage des Passionsweges der männlichen Sexualität. Historischer Standindex
dieser Impotenz. Aus dieser Impotenz geht ebensowohl seine Bindung an das seraphische
Frauenbild wie sein Fetischismus hervor. Hinzuweisen ist auf Bestimmtheit und
Präzision der Frauenerscheinung bei Baudelaire. Die Kellersche
»Dichtersünde«, »Süße Frauenbilder zu erfinden | Wie die bittere Erde sie nicht
hegt«, ist sicherlich nicht die seine. Kellers Frauenbilder haben die
Süßigkeit der Chimären, weil er ihnen die eigene Impotenz eingebildet hat. -
Walter Benjamin, Illuminationen. Frankfurt am Main 1977
Jakob Sprenger, Heinrich Institoris, Der Hexenhammer. München 1985 (dtv klassik,
zuerst 1487)
Chimäre (6) Interessant sind Fragen, ab welcher Anzahl von Genen
ein Lebewesen noch ein transgenes Tier ist oder zu einem Mensch wird.
Das hat natürlich ganz erhebliche Folgen. Sollten für die Herstellung
von Mensch-Tier-Chimären und für den Umgang mit ihnen andere Prinzipien
als für Tiere und für Menschen gelten? Und ab wann wird ein Tier
"humanisiert", auch wenn es körperlich und/oder kognitiv dem Menschen
nicht ähnelt? Science Fiction-Fragen drängen sich natürlich auch auf:
Was ist mit Chimären, die zwar einen Tierkörper besitzen, aber auch ein
menschliches Gehirn? Oder Chimären könnten den Körper von Menschen
haben, aber nur ein tierisches Gehirn oder nur ein Gehirn, das gerade
ausreicht, um das Wachstum und die Lebensfunktionen aufrechthält.
Hätten diese dann Anspruch auf humanen Umgang? Dürften mit ihnen
experimentiert, dürften sie beliebig getötet und ausgeschlachtet
werden, um Organe zu gewinnen?
- Florian Rötzer,
Telepolis vom 14. Dezember 2005
Chimäre (7), Holocephali, Unterklasse
der Knorpelfische mit drei Familien: Seekatzen (Chimaeridae) mit der 1 m langen,
in europäischen Gewässern in bis zu 1 000 m Tiefe lebenden Seeratte (Spöke,
Chimaera monstrosa), Langnasenchimären (Rhinochimaeridae), die in allen Meeren
bis in 2 600 m Tiefe leben und einen Giftstachel haben, und die Elefantenchimären
(Callorhynchidäe) in höchstens 180 m Tiefe um das südliche Afrika. -
Brockhaus multimedial 2007
Chimäre (8) Ich wünschte von ganzem Herzen,
daß die Gleichheit herrschte, ich hätte lieber keine
Untergebenen als einen Herrn über mir. Nichts bietet der Spekulation so glänzende
Möglichkeiten wie die Idee der Gleichheit. Aber nichts ist so undurchführbar
und chimärisch. - (vauv)
Chimäre (9)

- N. N.
Chimäre (9) Iobates, der König von Lykien, bat er Bellerophon, die Chimaira zu töten, ein feuerspeiendes weibliches Ungeheuer mit dem Haupt eines Löwen, dem Körper einer Ziege und dem Schwanz einer Schlange. «Sie ist», so erklärte er, «eine Tochter der Echidne, die mein Feind, der König von Karien, zu einem Haustier gemacht hat.» Bevor Bellerophon an seine Aufgabe ging, befragte er den Seher Polyeidos, der ihm riet, das geflügelte Pferd Pegasos zu fangen und zu zähmen. Dieses Pferd wurde von den Musen des Berges Helikon in Ehren gehalten, da es für sie den Brunnen Hippokrene geschaffen hatte, indem es seinen mondförmigen Huf auf den Boden stampfte.
Pegasos war zu der Zeit nicht auf dem Berge Helikon, doch fand ihn Bellerophon
in Peirene, als er auf der Akropolis von Korinth Wasser trank. Er warf einen
goldenen Zügel über dessen Haupt, ein Geschenk der Athene. Doch sagen manche,
daß Athene dem Bellerophon das bereits gezäumte Pferd Pegasos gab. Andere behaupten,
daß dies Poseidon tat, der in Wirklichkeit Bellerophons Vater war. Wie immer
es auch gewesen sei, Bellerophon besiegte die Chimaira: Er flog auf dem Rücken
des Pegasos über sie, durchbohrte sie mit Pfeilen und warf dann einen Bleiklumpen,
den er an der Spitze seines Speeres befestigt hatte, in ihr Maul. Der feurige
Atem der Chimaira schmolz das Blei, das ihre Kehle
hinabtropfte und ihre Eingeweide verbrannte. -
(myth)
Chimäre (10) Unter einem weiten grauen Himmel, in einer weiten staubigen Ebene, ohne Wege, ohne Gras, ohne eine Distel, ohne eine Nessel, begegnete ich einigen Männern, die gebückt dahingingen.
Jeder von ihnen trug auf seinem Rücken eine ungeheure Chimäre, die so schwer war wie ein Sack Mehl oder Kohlen oder das Gepäck eines römischen Fußsoldaten.
Aber das scheußliche Tier war nicht eine leblose Last; Im Gegenteil, es umklammerte und drückte den Mann mit seinen biegsamen und mächtigen Muskeln zu Boden; es krallte sich mit seinen beiden gewaltigen Klauen in die Brust seines Tragtiers ein, und sein fabelhafter Kopf ragte über die Stirn des Mannes hinaus, wie einer jener fürchterlichen Helme, mit denen die Krieger der Vorzeit den Schrecken des Feindes noch zu vermehren hofften.
Ich machte mich an einen der Männer heran und fragte ihn, wohin sie gingen. Er antwortete mir, daß er nichts darüber wüßte, weder er noch die anderen; daß sie aber ganz offenbar irgendwohin gingen, da sie von einem unbezwinglichen Bedürfnis getrieben würden vorwärts zu gehen.
Eine merkwürdige Feststellung: Auf dem Gesicht keines dieser Wanderer zeigte sich Empörung über dieses an seinem Halse hängende und auf seinem Rücken klebende gräßliche Tier; es war, als ob er es für ein Stück von sich selbst hielt. Alle diese ermüdeten und ernsten Gesichter zeigten keinerlei Verzweiflung; unter der griesgrämigen Wölbung des Himmels, die Füße schleppend im Staub eines Bodens, der ebenso trostlos war wie dieser Himmel, zogen sie dahin mit dem entsagenden Ausdruck von Menschen, die dazu verurteilt sind, immerwährend zu hoffen.
Und der Zug ging an mir vorüber und versank im Dunst des Horizonts, da, wo die Rundung des Planeten sich der Neugier des Menschenauges entzieht.
Und ein paar Augenblicke lang mühte mein Wille sich hartnäckig ab, das Geheimnis
zu begreifen; aber bald senkte sich die unwiderstehliche Gleichgültigkeit auf
mich nieder, und ich wurde von ihr mit schwererer Last beladen, als sie von
ihren drückenden Chimären. - Charles Baudelaire, Der Spleen von Paris. In:
C.B., Die Tänzerin Fanfarlo und Der Spleen von Paris. Zürich 1977

 |
||
 |
||
 |
 |
|
 |
||

 |
||
  |
 
|
|